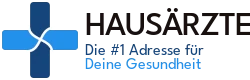Grippe (Influenza) – Symptome, Behandlung, Vorbeugung

Die Grippe, medizinisch Influenza, ist eine akut verlaufende Infektionskrankheit der Atemwege, die durch Influenzaviren ausgelöst wird und sich vor allem in den Wintermonaten rasant verbreiten kann. Viele Menschen unterschätzen die Erkrankung, weil sie sie mit einer einfachen Erkältung verwechseln, doch die Influenza kann deutlich schwerer verlaufen, hohes Fieber verursachen und insbesondere bei Risikogruppen zu ernsten Komplikationen wie Lungenentzündung führen. Für Patientinnen und Patienten, für Angehörige und auch für Hausärzte ist es deshalb wichtig, typische Symptome zu kennen, den Unterschied zur Erkältung zu verstehen und bei Bedarf zügig ärztlichen Rat einzuholen.
Dieser Beitrag erklärt ausführlich, was die Grippe eigentlich ist, wie sie übertragen wird, welche Symptome typisch sind, wie die Behandlung in der Hausarztpraxis aussieht und welche Möglichkeiten der Vorbeugung, allen voran die jährliche Grippeschutzimpfung, zur Verfügung stehen. Außerdem erfahren Sie, wann ein Arztbesuch besonders wichtig ist, wie Sie sich zu Hause richtig verhalten und welche Rolle einfache Maßnahmen wie Händewaschen, Hustenetikette und eine insgesamt gesunde Lebensweise für Ihr Immunsystem spielen. Ziel ist es, Ihnen praxisnahes Wissen an die Hand zu geben, damit Sie im Ernstfall schnell reagieren und sich selbst wie auch Ihre Mitmenschen besser schützen können.
Was ist die Influenza genau?
Unter Influenza versteht man eine Virusinfektion der oberen und unteren Atemwege, die durch Influenzaviren der Typen A, B oder seltener C verursacht wird. Vor allem Typ A und B sind für die jährlichen Grippewellen verantwortlich, die in Deutschland üblicherweise zwischen Herbst und Frühjahr auftreten. Das Virus befällt die Schleimhäute von Nase, Rachen und Bronchien und kann sich dort extrem schnell vermehren. Die Erkrankung beginnt meist plötzlich, häufig innerhalb weniger Stunden, und äußert sich durch ein stark ausgeprägtes Krankheitsgefühl.
Die Influenzaviren werden überwiegend über Tröpfcheninfektion übertragen. Das bedeutet: Beim Husten, Niesen oder Sprechen gelangen winzige Tröpfchen, die Viren enthalten, in die Luft und können von anderen Personen eingeatmet werden. Darüber hinaus ist auch eine Schmierinfektion möglich, wenn virushaltige Sekrete auf Händen oder Oberflächen landen und anschließend in Mund, Nase oder Augen geraten. In Gemeinschaftseinrichtungen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Schulen, Kitas und am Arbeitsplatz kann sich die Influenza daher besonders schnell verbreiten.
Warum verändert sich das Grippevirus so häufig?
Ein wichtiges Merkmal der Influenzaviren ist ihre hohe Wandlungsfähigkeit. Die Virusoberfläche ist von Eiweißstrukturen umgeben, die das Immunsystem als sogenannte Antigene erkennt. Diese Strukturen verändern sich durch kleinere Mutationen immer wieder, sodass das körpereigene Abwehrsystem frühere Infektionen oder Impfungen nur begrenzt als Schutz nutzen kann. Man spricht von Antigendrift, wenn sich das Virus schrittweise verändert, was für die jährlichen Grippewellen verantwortlich ist. In größeren Abständen kann es zu drastischeren Veränderungen, sogenannten Antigenshifts, kommen. Dann entstehen neue Virusvarianten, gegen die kaum jemand eine Immunität besitzt, was unter Umständen weltweite Grippewellen (Pandemien) auslösen kann.
Für die Praxis bedeutet das: Die Grippeimpfung muss jedes Jahr an die aktuell zirkulierenden Virusstämme angepasst werden, und auch Personen, die schon einmal eine Influenza durchgemacht haben, sind in den Folgejahren nicht automatisch geschützt. Aus diesem Grund empfehlen Fachgesellschaften insbesondere gefährdeten Gruppen die jährliche Auffrischung der Impfung.
Typische Symptome der Grippe
Die Influenza beginnt typischerweise plötzlich und heftig. Viele Betroffene berichten davon, dass es ihnen am Morgen noch gut ging und sie sich wenige Stunden später wie „vom Zug überrollt“ fühlen. Charakteristisch ist ein rascher Anstieg des Fiebers, häufig auf Werte über 38,5 bis 39 Grad Celsius, begleitet von Schüttelfrost, starken Kopf- und Gliederschmerzen, Muskelschmerzen und einem ausgeprägten Krankheitsgefühl. Die Betroffenen fühlen sich matt, abgeschlagen und haben kaum Energie, alltägliche Tätigkeiten auszuführen.
Zu den häufigsten Symptomen gehören:
- Plötzlicher Krankheitsbeginn mit starkem Unwohlsein
- Hohes Fieber, oft über 38,5 Grad Celsius
- Schüttelfrost und ausgeprägtes Frösteln
- Starke Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen
- Trockener, teilweise schmerzhafter Husten
- Halsschmerzen und Heiserkeit
- Ausgeprägte Müdigkeit und Erschöpfung
- Appetitlosigkeit und allgemeine Schwäche
Zusätzlich können Reizungen der Augen, Lichtempfindlichkeit, Brustschmerzen beim Husten oder Atemnot auftreten. Kinder reagieren häufig sensibler: Bei ihnen können Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen oder Durchfall hinzukommen. Nicht jede Grippe verläuft jedoch gleich – von sehr heftigen über moderate bis zu vergleichsweise milden Verläufen ist alles möglich. Gerade bei älteren Menschen kann das typische Fieber manchmal fehlen, während die allgemeine Schwäche im Vordergrund steht.
Grippe oder Erkältung – wie lassen sie sich unterscheiden?
Eine der häufigsten Fragen in der Hausarztpraxis lautet: „Habe ich nur eine Erkältung oder eine echte Grippe?“ Beide Erkrankungen werden zwar durch Viren ausgelöst, unterscheiden sich aber in Verlauf, Schweregrad und möglicher Komplikationsrate. Grundsätzlich ist die Erkältung, auch grippaler Infekt genannt, meist deutlich milder und beginnt eher schleichend, während die Influenza plötzlich und heftig einsetzt.
Wichtige Unterschiede sind:
- Krankheitsbeginn: Die Grippe beginnt abrupt innerhalb weniger Stunden, eine Erkältung entwickelt sich langsam über ein bis zwei Tage.
- Fieber: Bei der Grippe tritt häufig hohes Fieber auf, bei Erkältungen bleibt die Temperatur meistens normal oder nur leicht erhöht.
- Körperliche Schmerzen: Grippepatienten leiden typischerweise unter starken Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen, während diese bei einer Erkältung meist milder sind.
- Schnupfen: Eine Erkältung geht oft mit ausgeprägtem Schnupfen einher, bei der Grippe kann dieser zwar auftreten, steht aber häufig nicht im Vordergrund.
- Allgemeinzustand: Betroffene mit Influenza fühlen sich stark abgeschlagen, oft bettlägerig, während man mit einer Erkältung meist noch eingeschränkt alltagsfähig bleibt.
Im Alltag lässt sich die Unterscheidung nicht immer sicher treffen, insbesondere wenn Symptome atypisch sind oder der Verlauf mild bleibt. Bei Unsicherheiten, starkem Krankheitsgefühl, hohem Fieber oder Risikofaktoren wie chronischen Erkrankungen sollte daher immer die Hausärztin oder der Hausarzt hinzugezogen werden.
Wie lange dauert eine Grippe?
Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und Ausbruch der ersten Symptome, beträgt bei der Influenza meist nur ein bis zwei Tage. Die akuten Beschwerden mit Fieber, Schüttelfrost und starken Schmerzen halten in der Regel drei bis sieben Tage an. Besonders belastend ist jedoch, dass die Erschöpfung und reduzierte Leistungsfähigkeit oftmals noch deutlich länger anhalten können. Viele Betroffene fühlen sich zwei bis drei Wochen nach Beginn der Erkrankung noch müde und nicht vollständig belastbar.
Wichtig ist außerdem: Schon kurz vor Auftreten der ersten Symptome und in den ersten Krankheitstagen sind Infizierte besonders ansteckend. Das erklärt, warum sich die Influenza so schnell verbreiten kann, vor allem in geschlossenen Räumen und größeren Gruppen. Wer krank ist, sollte daher zu Hause bleiben, Kontakte reduzieren und insbesondere den engen Kontakt zu gefährdeten Personen vermeiden.
Mögliche Komplikationen der Influenza
Bei ansonsten gesunden Menschen verläuft eine Grippe zwar unangenehm, heilt aber in den meisten Fällen ohne bleibende Schäden aus. Dennoch kann es zu Komplikationen kommen, vor allem wenn das Immunsystem geschwächt ist oder Vorerkrankungen bestehen. Zu den häufigsten Komplikationen gehören bakterielle Superinfektionen, etwa eine eitrige Bronchitis oder eine Lungenentzündung. Diese entstehen, wenn Bakterien die durch das Virus geschädigten Schleimhäute besiedeln und eine zusätzliche Infektion auslösen.
Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Personen mit chronischen Herz- oder Lungenerkrankungen, Menschen mit Diabetes, Patientinnen und Patienten mit geschwächtem Immunsystem, Schwangere sowie kleine Kinder. Bei ihnen kann die Grippe schwerer verlaufen und auch seltenere Komplikationen wie Herzmuskelentzündungen (Myokarditis), Entzündungen des Gehirns (Enzephalitis) oder eine Verschlechterung bestehender Grunderkrankungen auslösen. Warnzeichen sind etwa zunehmende Atemnot, anhaltend hohes Fieber, Brustschmerzen, Verwirrtheit oder ein deutlich verschlechterter Allgemeinzustand.
Diagnose: Wie stellt der Hausarzt eine Grippe fest?
In der hausärztlichen Praxis basiert die Diagnose Influenza zunächst auf der typischen Kombination aus plötzlichem Krankheitsbeginn, charakteristischen Symptomen und der aktuellen Grippesaison. Im Gespräch erkundigt sich die Ärztin oder der Arzt nach Beschwerden, Vorerkrankungen, Medikamenten und möglichen Kontakten zu erkrankten Personen. Anschließend erfolgt eine körperliche Untersuchung, bei der besonders Lunge, Herz, Rachen und Nase beurteilt werden.
Zur Bestätigung der Verdachtsdiagnose kann ein Schnelltest eingesetzt werden, der mittels Abstrich aus dem Nasen- oder Rachenraum durchgeführt wird und innerhalb kurzer Zeit Hinweise auf Influenzaviren liefern kann. Diese Tests sind allerdings nicht in jeder Situation notwendig und werden insbesondere bei Risikopatienten, schweren Verläufen oder im Klinikbereich häufiger genutzt. In speziellen Fällen kann zusätzlich eine genauere Laboruntersuchung veranlasst werden, bei der das Virus mittels PCR-Test nachgewiesen wird.
Behandlung der Grippe: Was hilft wirklich?
Die Behandlung der Influenza richtet sich in erster Linie nach der Schwere der Erkrankung, dem individuellen Risiko für Komplikationen und dem Zeitpunkt des Krankheitsbeginns. Wichtig zu wissen: Gegen das Grippevirus selbst helfen klassische Antibiotika nicht, da sie nur gegen Bakterien wirken. Dennoch können Antibiotika nötig werden, wenn sich eine zusätzliche bakterielle Infektion auf die Virusgrippe aufpfropft, etwa in Form einer bakteriellen Lungenentzündung.
Bei den meisten Betroffenen steht eine konsequente symptomatische Behandlung im Vordergrund. Dazu gehören:
- Strikte körperliche Schonung: Wer an Grippe erkrankt ist, sollte sich ausruhen, im Bett bleiben und auf körperliche Anstrengung verzichten. Sport ist während und unmittelbar nach der Erkrankung tabu, um Herz und Kreislauf nicht zu überlasten.
- Ausreichende Flüssigkeitszufuhr: Durch Fieber und Schwitzen verliert der Körper viel Flüssigkeit. Wasser, Tee und klare Brühen helfen, den Flüssigkeitshaushalt im Gleichgewicht zu halten.
- Fiebersenkende Medikamente: Präparate mit Paracetamol oder Ibuprofen können Fieber und Schmerzen lindern. Sie sollten jedoch nicht ohne Rücksprache dauerhaft und nicht überdosiert eingesetzt werden. Bei Kindern gelten besondere Dosierungsempfehlungen.
- Hustenlindernde Maßnahmen: Warme Getränke, inhalieren mit Wasserdampf oder salzhaltigen Lösungen und eventuell nach ärztlicher Empfehlung Hustenmittel können quälenden Husten beruhigen.
- Nasentropfen oder -sprays: Kurzzeitig angewendete abschwellende Nasensprays können das Atmen erleichtern und das Wohlbefinden verbessern, sollten aber nicht länger als wenige Tage genutzt werden.
Für bestimmte Risikogruppen und in frühen Krankheitsstadien können außerdem antivirale Medikamente in Betracht kommen. Diese hemmen die Vermehrung des Virus im Körper und können den Verlauf mildern und die Krankheitsdauer verkürzen, wenn sie sehr früh, idealerweise innerhalb der ersten 48 Stunden nach Symptombeginn, begonnen werden. Ob eine solche Therapie sinnvoll ist, entscheidet die behandelnde Ärztin oder der behandelnde Arzt individuell.
Was kann man selbst zu Hause tun?
Neben den ärztlich empfohlenen Maßnahmen gibt es einiges, was Betroffene selbst tun können, um den Körper zu unterstützen und den Krankheitsverlauf möglichst angenehm zu gestalten. Wichtig ist, auf den eigenen Körper zu hören: Wer sich erschöpft fühlt, sollte schlafen und sich ausreichend Ruhe gönnen. Frische Luft im Zimmer durch regelmäßiges Lüften, eine angenehme Raumtemperatur und ausreichend Luftfeuchtigkeit können die Atemwege zusätzlich entlasten.
Viele empfinden warme Tees aus Kräutern wie Thymian, Salbei oder Lindenblüten als wohltuend, ebenso wie Hühnersuppe, die den Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt unterstützt. Leichte, gut verdauliche Kost entlastet den Körper, während Alkohol und Rauchen die Heilung behindern. Auch wenn der Appetit reduziert ist, sollten kleine Mahlzeiten nicht komplett ausfallen. Wichtig ist außerdem, sich von anderen Haushaltsmitgliedern so gut wie möglich fernzuhalten, um sie nicht anzustecken – etwa durch getrennte Handtücher, regelmäßiges Händewaschen und Husten in die Ellenbeuge statt in die Hand.
Wann sollte man unbedingt zum Hausarzt?
Nicht jede Grippe erfordert einen sofortigen Arztbesuch, doch es gibt klare Warnzeichen, bei denen Hausärztinnen und Hausärzte unbedingt aufgesucht werden sollten. Das gilt vor allem, wenn Risikofaktoren vorliegen oder wenn sich der Zustand trotz Schonung nicht bessert. Typische Gründe für einen Arztbesuch sind:
- Sehr hohes oder anhaltendes Fieber über mehrere Tage
- Zunehmende Atemnot, pfeifende Atmung oder Atemschmerzen
- Starke Brustschmerzen oder Herzrasen
- Verwirrtheit, Schwindel oder Bewusstseinsstörungen
- Husten mit blutigem oder grün-gelbem Auswurf
- Verschlechterung einer bekannten chronischen Erkrankung (z. B. Herzschwäche, COPD, Asthma, Diabetes)
- Grippeverdacht bei Schwangeren, sehr kleinen Kindern, Hochbetagten oder Menschen mit Immunschwäche
In diesen Fällen kann eine ärztliche Untersuchung helfen, Komplikationen frühzeitig zu erkennen, eine geeignete Therapie einzuleiten und zu entscheiden, ob eine Behandlung zu Hause ausreicht oder eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus notwendig ist. Viele Hausarztpraxen bieten in der Grippesaison spezielle Infektsprechstunden an – vor dem Praxisbesuch empfiehlt sich häufig ein kurzer Anruf, um das Vorgehen abzustimmen.
Vorbeugung: Wie kann man sich vor der Grippe schützen?
Der beste Schutz vor einer schweren Influenza besteht aus einer Kombination verschiedener Maßnahmen. An erster Stelle steht die jährliche Grippeschutzimpfung, die von Fachgesellschaften vor allem für bestimmte Risikogruppen ausdrücklich empfohlen wird. Daneben spielen einfache Hygieneregeln und ein gesundheitsbewusster Lebensstil eine wichtige Rolle, um das Immunsystem insgesamt zu stärken.
Zu den wichtigsten vorbeugenden Maßnahmen gehören:
- Jährliche Grippeschutzimpfung: Sie wird besonders für Personen ab 60 Jahren, Menschen mit chronischen Erkrankungen, Schwangere, medizinisches Personal und Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen empfohlen. Die Impfung sollte idealerweise im Herbst erfolgen, damit der Impfschutz zur Grippesaison voll aufgebaut ist.
- Hygieneregeln beachten: Regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife, Husten und Niesen in die Armbeuge, Nutzung von Einmaltaschentüchern und das Vermeiden enger Kontakte zu erkennbar erkrankten Personen senken das Ansteckungsrisiko.
- Menschenansammlungen meiden: Besonders während starker Grippewellen ist es sinnvoll, große Menschenansammlungen und lange Aufenthalte in schlecht belüfteten Räumen nach Möglichkeit zu reduzieren.
- Gesunde Lebensweise: Ausgewogene Ernährung, ausreichend Schlaf, regelmäßige Bewegung an der frischen Luft und der Verzicht auf Nikotin stärken die körpereigene Abwehr langfristig.
Die Grippeschutzimpfung im Detail
Die Grippeschutzimpfung ist ein zentraler Baustein in der Vorbeugung und wird jedes Jahr an die aktuellen Virusvarianten angepasst. Verwendet werden in der Regel inaktivierte (abgetötete) Impfstoffe, die keine Grippe auslösen können, sondern das Immunsystem gezielt auf die Erreger vorbereiten. Nach der Impfung braucht der Körper etwa zwei Wochen, um einen wirksamen Schutz aufzubauen. Der Schutz ist nicht hundertprozentig, kann aber deutlich das Risiko für eine Erkrankung und vor allem für schwere Verläufe senken.
Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt die jährliche Impfung insbesondere für Menschen ab 60 Jahren, für Personen mit chronischen Herz-, Lungen- oder Stoffwechselerkrankungen, für Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, für Schwangere ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel sowie für medizinisches Personal und andere Berufsgruppen mit viel Publikumsverkehr. Auch Personen, die engen Kontakt zu Risikopatienten haben, profitieren, da sie diese indirekt mit schützen. In vielen Fällen übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten der Impfung.
Grippe und Alltag: Was ist im Berufsleben wichtig?
Wer an Grippe erkrankt ist, sollte nicht zur Arbeit gehen – weder aus Rücksicht auf die eigene Gesundheit noch auf Kolleginnen und Kollegen. Körperliche Belastung während einer akuten Influenza erhöht das Risiko für Komplikationen wie Herzmuskelentzündungen, und gleichzeitig ist man in der ersten Krankheitsphase besonders ansteckend. Deshalb gilt: lieber einige Tage konsequent auskurieren, als sich zu früh wieder in den Alltag zu stürzen.
Arbeitgeber sind in der Regel über Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen informiert, die von der Hausärztin oder dem Hausarzt ausgestellt werden. Viele Unternehmen sensibilisieren ihre Mitarbeitenden außerdem dafür, im Krankheitsfall zu Hause zu bleiben, um Infektionsketten zu unterbrechen. Im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements kann zusätzlich zur freiwilligen Grippeimpfung im Unternehmen motiviert werden, was vor allem in Büros, Großraumbüros oder Pflegeeinrichtungen sinnvoll ist.
Grippe bei Kindern
Kinder stecken sich besonders häufig mit Influenzaviren an, da sie engen Kontakt in Schule oder Kita haben und Hygieneregeln noch nicht so konsequent einhalten können. Gleichzeitig können sie Viren leicht an Eltern, Großeltern oder Geschwister weitergeben. Bei Kindern verläuft die Grippe oft mit hohem Fieber, starker Müdigkeit, Kopf- und Bauchschmerzen, manchmal auch mit Übelkeit und Erbrechen. Eltern sollten aufmerksam auf das Allgemeinbefinden achten und bei Unsicherheit die Kinderarztpraxis kontaktieren.
Wichtig ist, dass Kinder während der Erkrankung viel trinken, sich ausruhen und gegebenenfalls fiebersenkende und schmerzlindernde Medikamente in der für Kinder geeigneten Dosierung erhalten – niemals auf eigene Faust Medikamente für Erwachsene geben. Bei anhaltend hohem Fieber, Trinkschwäche, Atemnot, ungewöhnlicher Schläfrigkeit oder anderen Warnzeichen ist eine ärztliche Untersuchung dringend notwendig. Auch bei Kindern kann die Grippeschutzimpfung, je nach Risiko, ein sinnvoller Baustein der Vorbeugung sein.
Grippe in der Schwangerschaft
Schwangere gehören zur besonderen Risikogruppe für einen schweren Verlauf der Influenza, da sich das Immunsystem während der Schwangerschaft verändert. Eine Grippe kann hier nicht nur für die werdende Mutter belastend sein, sondern auch mit einem erhöhten Risiko für Komplikationen einhergehen. Deshalb empfiehlt die STIKO die Grippeschutzimpfung ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel, bei zusätzlichem Risiko auch früher. Der inaktivierte Impfstoff gilt als sicher und kann dazu beitragen, sowohl die Mutter als auch das ungeborene Kind zu schützen.
Erkranken Schwangere dennoch an der Grippe, sollten sie frühzeitig mit der Frauenarztpraxis oder der Hausarztpraxis Kontakt aufnehmen. Eine engmaschige ärztliche Betreuung hilft, Komplikationen rechtzeitig zu erkennen und die bestmögliche Behandlung zu gewährleisten. Auch hier gilt: viel Ruhe, ausreichend Flüssigkeit und konsequente Schonung sind entscheidend.
Fazit: Grippe ernst nehmen, aber gelassen bleiben
Die Influenza ist eine ernstzunehmende Infektionskrankheit, die jedes Jahr zahlreiche Menschen in Deutschland betrifft und vor allem für ältere Menschen, chronisch Kranke, Schwangere und kleine Kinder gefährlich werden kann. Typisch sind ein plötzlicher Krankheitsbeginn, hohes Fieber, starke Kopf- und Gliederschmerzen sowie ein deutliches Krankheitsgefühl, das Betroffene oft für mehrere Tage ans Bett fesselt. Auch wenn die meisten Verläufe ohne bleibende Schäden ausheilen, kann die Grippe Komplikationen wie Lungenentzündungen oder Herzmuskelentzündungen nach sich ziehen – ein Grund mehr, sie nicht als harmlose Erkältung abzutun.
Zugleich gibt es viele Möglichkeiten, sich und andere zu schützen. Die jährliche Grippeschutzimpfung ist ein wichtiger Baustein, insbesondere für Risikogruppen und Personen mit viel Kontakt zu anderen Menschen. Ergänzend helfen einfache Hygieneregeln, ausreichender Schlaf, gesunde Ernährung, Bewegung und der bewusste Umgang mit Krankheitssymptomen im Alltag. Wer bei Verdacht auf Influenza, insbesondere mit Risikofaktoren oder schweren Beschwerden, frühzeitig seine Hausärztin oder seinen Hausarzt kontaktiert, schafft die besten Voraussetzungen für eine rasche Diagnose und eine passende Behandlung. So lässt sich die Grippe zwar nicht immer verhindern, aber ihre Auswirkungen können deutlich reduziert werden.